28.07.2025
Autor: Wolfgang Heumer
Gelegentlich erinnert sich Dr. Lara Kim Hünerlage an den Beginn ihrer wissenschaftlichen Karriere. Als Doktorandin am Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut befasste sie sich mit der Grundlagenforschung an Leuchtgarnelen – auch Krill genannt –, die im Arktischen Ozean in großen Massen vorkommen. Sie stellen ein wichtiges Glied in der maritimen Nahrungskette dar.
Seitdem die Meeresbiologin nach ihrer Promotion vor acht Jahren an das bundeseigene Thünen-Institut für Seefischerei in Bremerhaven wechselte, hat sie es hingegen mit einer Garnele zu tun, die nicht in solchen Massen vorkommt – die aber von großem wirtschaftlichem Interesse ist und deren schwankende Population voller Rätsel steckt. „Aus ökologischer Sicht spielt die Nordseegarnele eine ähnlich bedeutende Rolle in ihrem Ökosystem wie der Krill im Arktischen Ozean“, sagt Hünerlage. „Allerdings bringen die Komplexität des Ökosystems Wattenmeer sowie die menschliche Bewirtschaftung ganz andere Herausforderungen für die Forschung an dieser Art mit sich.“
Die 39-Jährige koordiniert die Forschung und Beratung politischer Entscheidungsträgerinnen und -träger zu dem Meerestier mit dem wissenschaftlichen Namen Crangon crangon, besser aber als Krabbe oder – norddeutsch – Granat bekannt. „Obwohl die Nordseegarnele das wichtigste Fangobjekt der deutschen Küstenfischer ist, können wir die Bestandsentwicklung noch nicht zuverlässig vorhersagen“, betont sie.
Wichtigstes Fanggut der Küstenfischer geht immer seltener ins Netz
Ohne die Nordseekrabben würde es den deutschen Küstenfischern vermutlich noch schlechter gehen als derzeit. Mit rund 25 Millionen Euro machten die Garnelen mehr als die Hälfte der Gesamterlöse aus, die die Fischereibetriebe 2024 mit ihren Anlandungen in den Häfen Niedersachsens und Schleswig-Holsteins erzielten. Auch in der Fangmenge war die Garnele führend: Mit 3.340 Tonnen brachten die Krabbenfischer fast sechsmal so viel an Land wie ihre Kollegen, die auf Scholle (661 Tonnen) oder Sprotte (609 Tonnen) gegangen waren.
Dennoch war 2024 eines der schlechtesten Fangjahre für die Krabbenfischerei. Gegenüber dem Durchschnitt in den Jahren von 2000 bis 2015 ging ihr nur rund ein Drittel der gewohnten Menge ins Netz. „Die Situation ist besonders, weil die niedrigen Fänge seit Jahren anhalten“, sagte Philipp Oberdörffer, Fischereiberater bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, im vergangenen Sommer in einem Interview. Die Kundschaft bekam dies deutlich zu spüren: Krabbenbrötchen verteuerten sich auf bis zu 15 Euro pro Stück, zum Teil bot der Handel Krabbenprodukte gar nicht mehr an.
Nordseegarnele verbirgt ihren Lebensplan geschickt
Warum die Krabbenbestände über die Jahre hinweg so stark schwanken und derzeit auf einen Tiefstand zuschwimmen, will das Bremerhavener Thünen-Institut für Seefischerei herausfinden. Zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen erhebt Hünerlage biologische Daten, spricht mit den Fischern über die jüngsten Entwicklungen, begleitet sie auf Fangreisen und trifft sich in internationalen Arbeitsgruppen mit Forschenden aus dem In- und Ausland – insbesondere aus den anderen wichtigen Krabben-Fangnationen Niederlande, Dänemark und Belgien.
Dennoch verbirgt die Nordseegarnele ihren Lebensplan geschickt im trüben Wasser des Wattenmeeres. Bereits seit 2001 arbeitet das Thünen-Institut für Seefischerei in einer Arbeitsgruppe des Internationalen Rats für Meeresforschung in Kopenhagen an der Frage, wie die Garnelenfischerei durch verbesserte Vorhersagemodelle der Population planbarer werden kann. „Die Herausforderung besteht darin, dass wir es mit ganz vielen im Detail unbekannten und damit schwer vorherzusagenden Faktoren zu tun haben, die die Bestandsentwicklung beeinflussen“, sagt die Meeresbiologin.
„Temperatur und Räuberdruck wirken sich auf die Fangmengen aus“
Gründe für das schwankende Vorkommen gibt es viele. Zum Beispiel setzen steigende Wassertemperaturen das Ökosystem Nordsee zunehmend unter Druck – das bleibt auch für die Nordseegarnele nicht folgenlos. „Es sind nicht nur Räuber verschwunden, sondern auch neue hinzugekommen“, sagt Hünerlage. So zählen etwa Quallen und Kalmare zu den Fressfeinden der empfindlichen Larven. Die Nordseegarnele vermehrt sich das ganze Jahr über und wächst schnell. Das sei zwar ein Vorteil in einem dynamischen Lebensraum wie dem Wattenmeer: „Aber sie ist kurzlebig und genau das macht sie auch anfällig, denn der erwachsene Bestand, den auch die Fischerei nutzt, besteht im Wesentlichen aus nur einem Jahrgang“, erläutert die 39-Jährige. „Das bedeutet, dass Umweltbedingungen wie Temperatur oder Räuberdruck sich direkt und unmittelbar auf die Fangmengen auswirken.“
Die Wassertemperatur beeinflusst direkt den Reifeprozess der Garnelen: „In warmen Wintern, wie wir sie in den letzten Jahren immer häufiger beobachten, verläuft die Embryonalentwicklung beschleunigt, was für einen Teil der Nachkommen zu einem verfrühten Schlupfzeitpunkt führt“, berichtet die Wissenschaftlerin. Im Vergleich zu kälteren Wintern ergibt sich daraus für viele Individuen ein ungünstigerer Start. Denn frühe Schlupfzeitpunkte fallen nicht zwangsläufig mit einem ausreichenden Nahrungsangebot oder geeigneten Umweltbedingungen zusammen. So kann es zu einem denkbar schlechten Auftakt für den neuen Jahrgang kommen.
Industrielle Nordsee-Nutzung hat Folgen für den Bestand
Bestandsveränderungen werden zusätzlich auch durch unmittelbare menschliche Faktoren ausgelöst oder beschleunigt: „Die Nordsee wird beispielsweise durch den starken Schiffsverkehr, den Bau von LNG-Terminals und die begleitende Infrastruktur oder die zunehmende Anzahl an Windparks längst sehr stark industriell genutzt.“ Zudem hat die Fischerei einen maßgeblichen Einfluss auf die Populationsgröße der Nordseegarnele. Feste Fangquoten gibt es bislang nicht, da die für eine sinnvolle Festlegung erforderlichen Vorhersagemodelle zur Bestandsentwicklung fehlen.
Dennoch setzen viele Fischer freiwillig auf Nachhaltigkeit und haben sich dem Zertifizierungsprogramm des Marine Stewardship Council (MSC) angeschlossen: „Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass die Fischer schon aus eigenem Interesse sorgsam mit den Beständen umgehen wollen“, ist Dr. Lara Kim Hünerlage überzeugt.
Zurzeit untersuchen die Thünen-Forschenden, welchen Einfluss Gezeiten und Meeresströmungen auf den Krabben-Nachwuchs haben. „Über die Verdriftung der im Freiwasser lebenden Garnelenlarven sowie über die genauen Herkunftsorte einer jeden heranwachsenden Kohorte an Nordseegarnelen, die letztlich in den Fangnetzen der Fischerei landet, haben wir bislang nur wenig Kenntnisse“, sagt die Wissenschaftlerin.
Die Frage, warum es entlang der Küste mal mehr und mal weniger Nachwuchsgarnelen gibt, müsse daher aktuell noch unbeantwortet bleiben, betont sie. Weil die Forschung so komplex und wirtschaftlich wichtig ist, werden sich Hünerlage und ihre Kolleginnen und Kollegen vermutlich auch über den aktuell bis 2027 angesetzten Projektzeitraum hinaus mit der Frage beschäftigen müssen, warum die Nordseekrabben ausbleiben.

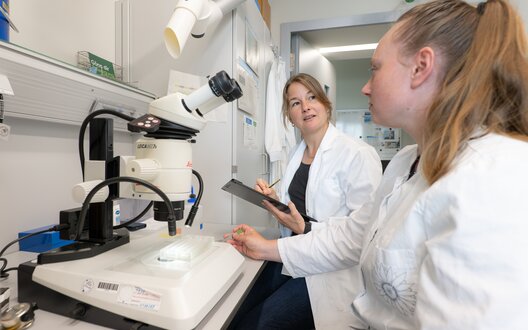

Pressekontakt:
Dr. Lara Kim Hünerlage, Wissenschaftlerin am Thünen Institut für Seefischerei – Arbeitsbereich Meeresökosysteme, Tel.: +49 471 94460 368, E-Mail: kim.huenerlage@thuenen.de
Der Pressedienst aus dem Bundesland Bremen berichtet monatlich über Menschen und Geschichten aus dem Bundesland Bremen mit überregionaler Relevanz, herausgegeben von der WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH. Bei den Artikeln handelt es sich nicht um Werbe- oder PR-Texte, sondern um Autorenstücke, die von Journalistinnen und Journalisten geschrieben werden. Es ist erwünscht, dass Redaktionen den Text komplett, in Auszügen oder Zitate daraus übernehmen.
Bildmaterial:
Das Bildmaterial ist bei themengebundener Berichterstattung und unter Nennung des jeweils
angegebenen Bildnachweises frei zum Abdruck.
Foto 1: Dr. Lara Kim Hünerlage forscht zur Entwicklung der Krabbenbestände. ©WFB/Björn Hake
Foto 2: Im Labor werden die Tiere analysiert, um Trends zu erkennen. ©WFB/Björn Hake
Foto 3: Krabbenlarven in einer Petrischale. ©WFB/Björn Hake
Bei Fragen schreiben Sie einfach eine E-Mail an: pressedienst@bremen.de